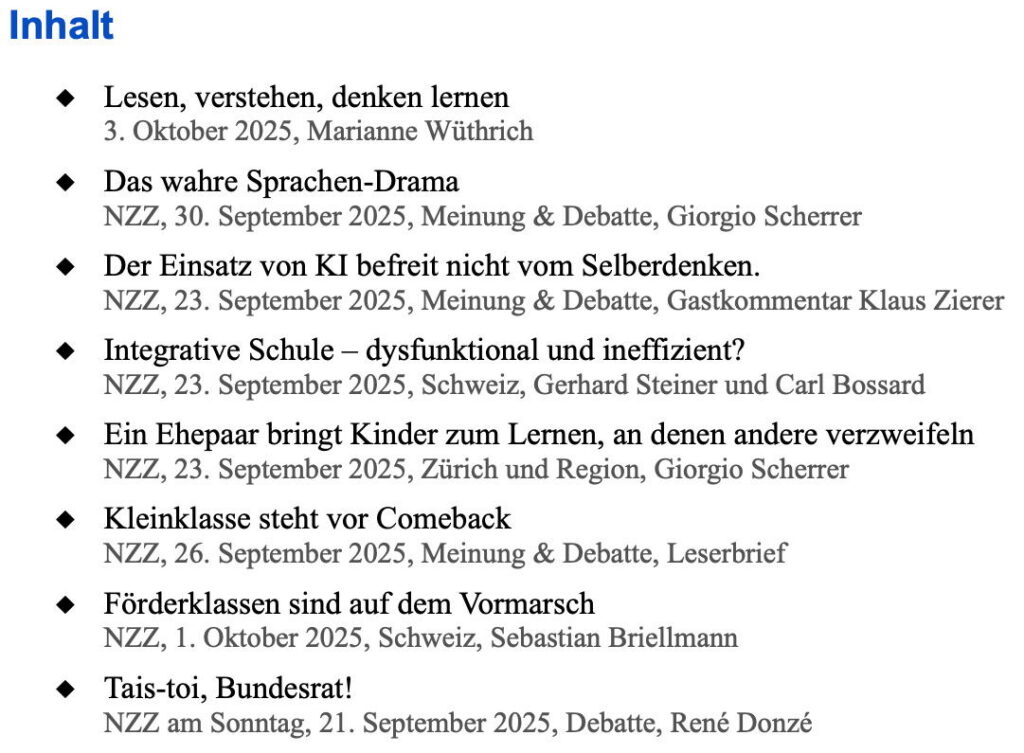Lesen, verstehen, denken lernen
Lassen wir diesmal das Gestürm zum Fach Französisch beiseite, wonach der nationale Zusammenhalt angeblich gefährdet sei, wenn die Jugendlichen erst in der Sekundarschule Französisch lernen (als Gegenrede drucken wir lediglich den Minitext «Tais-toi, Bundesrat» ab), und wenden wir uns einmal mehr den Grundlagen des Lernens zu. Dazu können wir Ihnen gleich mehrere hochkarätige Zeitungsartikel anbieten.
Ein brandneuer Bildungsartikel in der NZZ erinnert daran, dass das grösste Problem der Schweizer Volksschule nicht die Fremdsprachen sind, sondern die mangelhaften Deutschkenntnisse eines erheblichen Teils unserer Jugend. Der Leserschaft unseres Newsletters ist die sinkende Lesefähigkeit unserer Kinder und Jugendlichen seit Jahren bekannt – gut, dass die NZZ diesen Fakt und seine Folgen mit dem nötigen Ernst aufgreift. Redaktor Giorgio Scherrer benennt die schwerwiegenden Auswirkungen des Lesenotstands: auf den einzelnen Menschen, aber auch auf die Erhaltung und Weiterentwicklung unserer Kultur sowie auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Lernen im analogen Raum
Besonders bemerkenswert: Der Autor, der selbst zu den «Digital Natives» gehört (Jahrgang 1995), bezeichnet Chat-GPT und Co. als «Brandbeschleuniger» der Lese-Katastrophe, den es dringend zu bekämpfen gilt. Er verweist auf den US-amerikanischen Psychologen Jonathan Haidt, der sich für das Verbot von Handys in den Schulen einsetzt, weil diese die menschliche Aufmerksamkeitsspanne in den Köpfen unserer Kinder zerstören. Scherrer spinnt den Faden weiter: auch der Einsatz digitaler Hilfsmittel in den Schulzimmern sei auf das Nötigste zu reduzieren. Denn «die Schule sollte ein Ort sein, an dem Kinder die über Jahrhunderte verfeinerten Kulturtechniken des Lesens, Schreibens und Diskutierens in geschütztem Rahmen erlernen können. Dafür braucht es Zeit und Raum». Gut, das von einem Vertreter der jungen Generation zu hören.
Denken als Grundbedingung der menschlichen Existenz
Einer, der schon seit langem die Frage wälzt, wie die Schule aussehen sollte, welche die Jugend stark macht für ein Leben in einer fordernden Welt, ist Pädagogikprofessor Klaus Zierer. Angesichts der Durchdringung unseres Lebens mit sogenannter künstlicher Intelligenz, der wir die «Lösung» von Problemen aller Art überlassen, weist er in seinem Artikel eindringlich darauf hin: Es ist das Denken, was den Menschen im Kern ausmacht. Denn Denken ist die Grundbedingung der menschlichen Existenz – Nur wer denken lernt, kann seine Vernunft entwickeln und seine Umwelt mitgestalten.
Zierer hat zwar Verständnis dafür, dass wir Menschen aus Bequemlichkeit manchmal lieber «denken lassen», weil selber Denken bekanntlich anstrengend ist. Wie oft habe ich schon einen Text «deepln» lassen, statt ihn selbst von Französisch oder Englisch ins Deutsche zu übersetzen. Das ist mit meinem Bildungsrucksack ja auch nicht schlimm. Aber wenn Jugendliche ihre Informationen unüberprüft bei Google beziehen, wenn sie ihre Texte durch KI schreiben und zusammenfassen lassen, nicht gelegentlich, sondern regelmässig, dann hat das tiefgreifende Folgen für ihre psychische und geistige Entwicklung. Auf dem Boden des selbstorganisierten Lernens und der Kompetenzorientierung gemäss Lehrplan 21 ist die Wirkung von KI noch weit verheerender. Denn sie wird verstärkt durch die fehlende gründliche Einführung in das Lernen, und zwar durch eine Bezugsperson, nicht durch eine Software. So verkümmert die Lern- und Denkfähigkeit vieler Kinder von Beginn ihrer Schulzeit an. Dass dieser Niedergang der Bildung auch schwere Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft und besonders auf deren Demokratiefähigkeit hat, wie Klaus Zierer festhält, versteht sich von selbst.
Kritisch hinterfragen und besinnliches Denken lernen
Etwas anderes ist für die geistig-psychische Robustheit unserer Jugendlichen ebenso einschneidend. Was sie in den sogenannten «sozialen Netzwerken» alles an Un- und Halbwahrheiten aufgetischt bekommen, wie sie weltanschaulich-ideologisch beeinflusst und in Richtungen gelenkt werden, die für ihre persönliche Entwicklung höchst schädlich sein können – da schaudert's einen. Es ist an sich richtig, dass Klaus Zierer dazu auffordert, KI kritisch zu hinterfragen, um nicht in eine fatale Abhängigkeit von Systemen zu geraten und manipulierbar zu werden. Aber seine Empfehlungen, wie man aus dieser Sackgasse herausfinden und wieder fähig werden kann, selber zu denken, wenden sich an erwachsene und reife Menschen, die in ihrer Jugend bereits gelernt haben zu denken.
Wie sollen aber unsere Kinder diese Fähigkeit überhaupt erlangen? Da stehen wir Erwachsenen in der Pflicht, Eltern, Grosseltern, Lehrerinnen. Und damit kommen wir zum Lernen und zum Lesen im analogen Raum zurück, das Giorgio Scherrer einfordert. An uns ist es, die Kinder fürs Lesen zu gewinnen: gemeinsam Bilderbücher anschauen, vorlesen, miteinander lesen, spannende Bücher bereitstellen, die auch Werte vermitteln, mit den Kindern darüber sprechen und diskutieren. Nicht nur zu Hause, denn das ist nicht in allen Familien möglich, sondern in der Schule muss Zeit und Raum dafür sein, zum Wohl aller Kinder, aber ganz besonders im Zeichen der Chancengleichheit.
Konzentrierter Unterricht und Förderklassen statt «Disco-Betrieb»
In ihrem Artikel zur integrativen Schule führen Gerhard Steiner und Carl Bossard die Leser einmal mehr zu den Grundlagen des Lernens. Die Schule muss ein Ort sein, wo die Lehrerin in Ruhe und Kontinuität unterrichten kann, so dass die Schüler konzentriert lernen, das Gelernte verstehen und festigen können. Mit der anschaulichen Etikette «Disco-Betrieb» versehen die Autoren viele unserer heutigen Schulklassen: zahlreiche Unterbrüche, individualisiertes Lernen ohne adäquate Rückmeldungen, ausufernde Fördermassnahmen im Klassenbetrieb, wenig Gelegenheit zum Üben und Vertiefen. Hier fehlen die Bedingungen für ein Lernen, das die Kinder so voranbringt, wie es notwendig und auch möglich wäre. Das gilt übrigens nicht nur für Schüler mit Lernproblemen.
Als Alternative zur heutigen unbefriedigenden Situation in vielen Schulklassen empfehlen die beiden erfahrenen Pädagogen eine stärkere Fokussierung auf die Lernprozesse in den Regelklassen und als sinnvolle Ergänzung dazu Förderklassen. Kinder mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten können dort im gemeinschaftlichen Miteinander mit der Lehrerin und den Mitschülern echte Lernfortschritte machen und werden dadurch zum weiteren Lerneinsatz motiviert.
Lebendiger Bericht aus einer Kleinklasse
Wie es in einer Kleinklasse zugehen kann, zeigt ein herrlicher, lebensfroher Bericht aus Dietikon. Bei der Lektüre geht einem das Herz auf! Hier wird ein für allemal mit der Behauptung aufgeräumt, die Platzierung in einer Kleinklasse sei diskriminierend für die Kinder. Was der Zürcher Kantonsrat in Anwendung der Förderklasseninitiative beschlossen hat, wird in Dietikon bereits seit längerem umgesetzt: Die Klasse ist im selben Schulhaus untergebracht wie die Regelklassen, geführt wird sie von zwei festen Bezugspersonen, die Kinder verbringen einen Morgen pro Woche in ihrer angestammten Klasse und drei Viertel der Schüler schaffen es, nach ein bis zwei Jahren ganz in die Regelklasse zurückzukehren. Eine wichtige Besonderheit der Dietiker Kleinklasse: Damit die pädagogisch anspruchsvolle Arbeit noch besser gelingen kann, wird die aktive Beteiligung der Eltern im Unterricht und an Elternabenden vorausgesetzt. Die Familienklasse ist also gleichzeitig auch eine Art Selbsthilfegruppe für die Eltern. Und nicht zu vergessen: «Der Nutzen der Familienklasse beschränkt sich nicht auf die zehn Kinder, die sie besuchen. Sie soll auch den Kindern in regulären Klassen das Lernen erleichtern», stellt NZZ-Redaktor Giorgio Scherrer, der die Klasse besucht hat, fest.
In diesem Sinne schliessen wir unsere Textsammlung ab mit der erfreulichen Mitteilung aus dem Kanton Aargau, wo der Grosse Rat ebenfalls Förderklassen einführen will.
Bleiben wir am Ball!
Für das Redaktionsteam:
Marianne Wüthrich