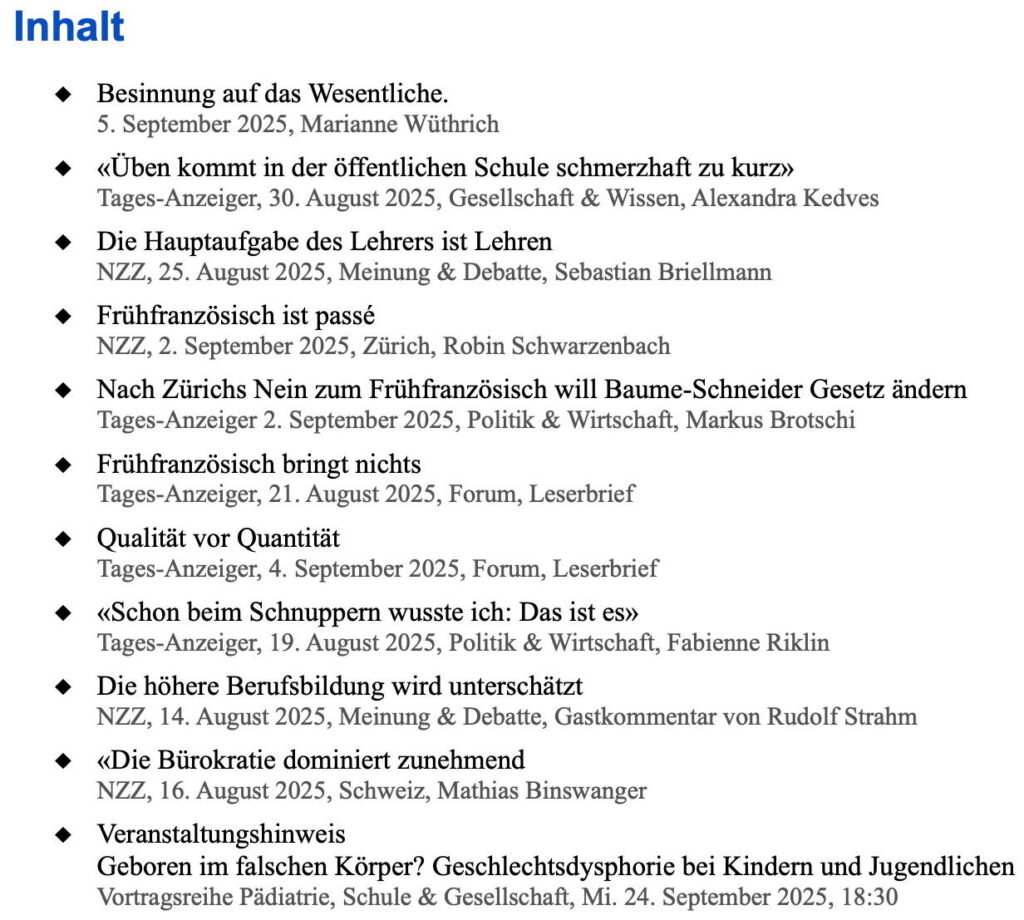Besinnung auf das Wesentliche
Bevor wir uns dem sensationellen Entscheid des Zürcher Kantonsrats zuwenden, dass Französisch künftig erst in der Oberstufe auf dem Lehrplan stehen soll, widmen wir uns zuerst der grundsätzlichen Frage, worum es denn in der Schule eigentlich geht. «Um das Lernen», sagt der Pädagoge Carl Bossard im Tages-Anzeiger-Interview, «um das wirklich bildungswirksame Lernen». Unermüdlich erklärt er jedem, der es hören will, was das beinhaltet: «systematisches Aufbauen und Verstehen; Konsolidieren durch Festigen und Üben; und schliesslich Anwendungsaufgaben stellen,um zu sehen, ob das Gelernte richtig verstanden und verinnerlicht wurde.» Von den reichlich unbedarften Einwürfen der Journalistin – «geistloser Drill», «endloses Rechenblätterlösen» usw. – lässt sich der erfahrene Lehrer nicht erschüttern. Er bleibt dabei, dass ohne Fundament weder verstehendes Lesen noch selbständiges Denken möglich ist, und dass Lernen und Üben viel Zeit brauchen. Deshalb muss der Lehrplan 21 notwendigerweise abgespeckt werden, vor allem die Frühfremdsprachen. Der Autor kritisiert die Pädagogischen Hochschulen, welche unter dem Schlagwort «vom Lehren zum Lernen» die zentrale Bedeutung des Lehrers und seines Unterrichts in Frage stellen und stattdessen die Autonomie des Kindes als Ausgangspunkt propagieren, obwohl diese in Wirklichkeit erst Ziel des Lernens sein kann.
In eine ähnliche Richtung geht Sebastian Briellmann in seinem Kommentar in der NZZ. Es ist eine besondere Freude, dass ein junger Journalist eine «Rückbesinnung der Schule aufs Wesentliche» fordert, nämlich «auf einen Unterricht, in dem der Lehrer der Chef ist und entscheidet, welches Wissen vermittelt wird.» Damit dies in Ruhe möglich wird, fordert Briellmann ein durchlässigeres System als die Integration aller mit ihren zahlreichen Sondersettings, Lerninseln und anderem mehr. Statt der heute üblichen «Überdiagnostizierung» der Kinder, die manchmal in Sonderschulen landen, wo sie gar nicht hingehören, verlangt er wie viele Lehrer, Eltern und kantonale Parlamente Förderklassen für Kinder, die mehr Zeit brauchen, um die Lernziele zu erreichen.
Unseren Lesern sind diese Erkenntnisse des erfahrenen Pädagogen und des jungen Journalisten nichts Neues, aber wenn wir das aufgeregte Gegacker um die Verschiebung des Französischlernens auf die Oberstufe im Kanton Zürich und anderswo hören, tut ein Innehalten und Besinnen auf den Kern des Lernens not.
Französischlernen in der Sekundarschule – aber richtig!
Unser Kollege Hans-Peter Köhli bringt es in seinem Leserbrief auf den Punkt: «Das Frühfranzösisch an der Primarschule bringt null und nichts und belegt auf der Stundentafel wertvolle Lektionen, die dafür eben im Deutsch fehlen.» In diesem Sinne hat der Zürcher Kantonsrat am 2. September mit 108 zu 64 Stimmen deutlich der Verschiebung des Faches Französisch auf die Oberstufe zugestimmt. Die Mehrheit der deutschsprachigen Kantone haben diesen Schritt schon früher getan oder sind dran.
Wer behauptet, der Zürcher Beschluss schade dem nationalen Zusammenhalt, geht darüber hinweg, wie «wirklich bildungswirksames Lernen» geht. Seit Jahren ist bekannt, dass die Theorie vom «Sprachbad» praktisch nur dann funktioniert, wenn Kinder über längere Zeit in einer französischsprachigen Umgebung sind und dort aktiv französisch hören, lesen, sprechen und möglichst auch schreiben. Idealerweise natürlich in einer zweisprachigen Familie (in meiner Gymiklasse hatten wir zwei bilingue Mitschüler, auf die wir verständlicherweise neidisch waren, weil ihr Niveau für jeden anderen unerreichbar war, jedenfalls solange er nicht die Gelegenheit hatte, über lange Zeit im Sprachgebiet zu leben). Für alle anderen könnten längere Sprachaufenthalte mit Teilnahme am Schulunterricht oder regelmässige Besuche in französischsprachigen Familien mit gemeinsamen Gesprächen und Lesestunden oder ähnliches ein «kleines Sprachbad» werden. Aber für die grosse Mehrheit der Kinder sicher nicht in der Primarschule, wo sie, vor allem auch die vielen Fremdsprachigen, dringend zuerst einmal genug Zeit brauchen, um Deutsch zu lernen.
Wer weiss, wie Lernen funktioniert, dem ist sonnenklar: Die paar Französischstunden in der Primarschule schaffen in den Köpfen der meisten Kinder mehr Verwirrung als Sprachkenntnisse, so dass sie nicht einmal imstande sind, in der Romandie ein Mineralwasser zu bestellen. Deshalb sollten wir die Zeit gescheiter zum intensiven Deutschlernen verwenden. Und dann, in der Sekundarschule, ohne Vorbelastung durch das entmutigende Erlebnis, in den Franz-Stunden nichts Rechtes gelernt zu haben, könnten die Jugendlichen ganz vorne anfangen. Und zwar in einem geführten und strukturierten Unterricht, mit einer Lehrerin, die selbst die Sprache sehr gut beherrscht und ihrer Klasse den Aufbau der französischen Sprache und die Schönheiten der französischen Kultur näherzubringen weiss. Gegen Ende der Oberstufe, wenn die Schüler schon einige Grundkenntnisse haben und sich ein wenig verständigen können, wäre dann ein Sprachaustausch kein Frust, sondern wirklich «de Plausch». Nur so trägt der Französischunterricht zum Zusammenhalt und zum gegenseitigen Verständnis bei, was unbedingt zu fördern und zu unterstützen ist.
Wollen wir unserer Jugend diese Chance nicht ermöglichen, statt zu jammern und mit dem Eingreifen des Bundes zu drohen?
Dem dualen Berufsbildungssystem Sorge tragen
Als alte Berufsschullehrerin kann ich's nicht lassen, das Thema aufzugreifen. In der Schweiz entscheiden sich nach wie vor über 60 Prozent der Jugendlichen für eine Berufslehre, ist im Tagi zu erfahren. Wenn man liest, wie drei junge Menschen von ihrem Lehrbeginn erzählen, geht einem das Herz auf. «Älteren Menschen etwas Gutes zu tun, macht mir Freude», sagt Elin Stalder, die ihre Lehre als Fachfrau Gesundheit in einem Alterszentrum im Sommer begonnen hat. Sie fährt fort: «Mein Urgrosi habe ich oft im Altersheim besucht und die Zeit dort mit ihr immer sehr genossen. Aber ich habe auch Respekt davor, wenn die erste Person aus dem Allmendguet stirbt, die mir ans Herz gewachsen ist.» So spricht eine 15Jährige! Eine Solarinstallateurin erinnert sich daran, wie hart die ersten Wochen in der Lehre waren: «Der Bruch zwischen Schule und Lehre ist ziemlich abrupt.» Das habe ich bei vielen meiner früheren Schüler gehört – aber sie rappelten sich wieder auf und meisterten ihren Alltag und ihr Leben. So auch die junge Rebeca Barcenas Perez, die ihren Abschluss gut schaffen will, mit dem Ziel, eine eigene Firma zu gründen: «Vielleicht auch in Spanien, der Heimat meines Vaters. Dort gibt es noch eine Menge Dächer ohne Panels.» Einen Einblick in die gute Durchlässigkeit unseres Schulsystems gibt der junge Automobilfachmann Leandro Schlatter. Er hat, weil er mit dem Schulunterricht Mühe hatte, zuerst eine zweijährige Lehre gemacht und mit dem Berufsattest abgeschlossen. Jetzt kann er zwei Jahre anschliessen, um das eidgenössische Fähigkeitszeugnis doch noch zu erreichen. Und weil er als Autoliebhaber gerne schnell fährt, rast er nicht über die Autobahn, sondern spart für einen geeigneten Wagen und rüstet ihn für die Rennstrecke auf, nach dem Ratschlag seines Vaters: «Wenn du Gas geben möchtest, dann geh dorthin.» Auch das ist unsere Jugend!
Aus Wertschätzung für das wichtige und hochdifferenzierte duale Bildungswesen der Schweiz bieten wir Ihnen zum Abschluss zwei Artikel zur höheren Berufsbildung an. Thema des ehemaligen SP-Nationalrates und eidg. Preisüberwachers Rudolf Strahm ist die höhere Berufsbildung HBB. Sie umfasst über 440 verschiedene Studien, fast 30'000 Absolventen haben letztes Jahr einen solchen Abschluss gemacht. Gemäss Umfragen sind sie die meistbegehrten Fachkräfte und stellen das «tragende mittlere Kader für die KMU-Wirtschaft». Denn sie bringen von der Berufslehre «die praktischen Fähigkeiten von der Pike auf» mit und von der höheren Berufsbildung das höhere technische Fachwissen. Deshalb weisen sie die tiefsten Arbeitslosenquoten und die höchsten Beschäftigungsquoten auf. Trotz all dieser Vorteile fehle den HBB-Absolventen die internationale Vergleichbarkeit ihrer Titel, kritisiert Rudolf Strahm. Damit ihre Abschlüsse als gleichwertig anerkannt werden wie die akademischen, will der Bundesrat nun die Titel «Professional Bachelor» und «Professional Master» einführen, mit Zustimmung aller Wirtschaftsverbände, aber zum Missfallen von Swissuniversities, dem Verein der Schweizer Hochschulen. Strahm bezeichnet diesen Widerstand als Standesdünkel. Das kann schon sein. Trotzdem leuchtet mir nicht recht ein, warum unsere besten und gefragtesten Berufsleute sich unbedingt mit den Allerweltstiteln aus dem fragwürdigen Bologna-Prozess schmücken wollen. Offensichtlich wissen die Personalchefs der Schweizer Unternehmen auch ohne diese Neuerung, wo sie die guten Fachleute finden.
Zum Schluss eine anspruchsvolle Analyse des Schweizer Bildungs-Zustands des Ökonomen Mathias Binswanger, die einigen Grund zum Nachdenken gibt. Unter anderem rechnet Binswanger mit der Kompetenzorientierung des Lehrplan 21 ab: Dass Kompetenzen für die Wirtschaftswelt wichtiger sein sollen als Wissen, sei ein «fundamentaler, ja gefährlicher Irrtum»: «Wenn ich (aber) nichts weiss, keine Fakten im Gehirn habe, die ich abrufen kann, dann kann ich nicht sinnvoll denken. Dass Wissen vernachlässigt, dessen Wichtigkeit heruntergespielt wird, weil man ja alles nachschauen kann: Das führt zu Pseudo-Kompetenzen, die mehr Schein als Sein sind.» Wie Rudolf Strahm kommt Binswanger zum Schluss, dass die höhere Berufsbildung nicht immer genügend gewürdigt wird, aber von einem anderen Ansatz her. Weil aus unseren Schulen immer mehr Leute mit schlechteren Leistungen kommen, glaube man, für ausgeschriebene Stellen immer höhere Qualifikationen verlangen zu müssen. Damit bewirke man, dass junge Menschen mit guten handwerklichen oder technischen Fähigkeiten unbedingt studieren wollen. Wir müssten wieder die gute Leistung honorieren, nicht eine wohlklingende Weiterbildung, hält Mathias Binswanger fest.
Also doch nicht auf die Master- und Bachelor-Etiketten starren, sondern den Menschen mit seinen Fähigkeiten und seiner Lebens-Bildung sehen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Stöbern in den aktuellen Texten.
Marianne Wüthrich