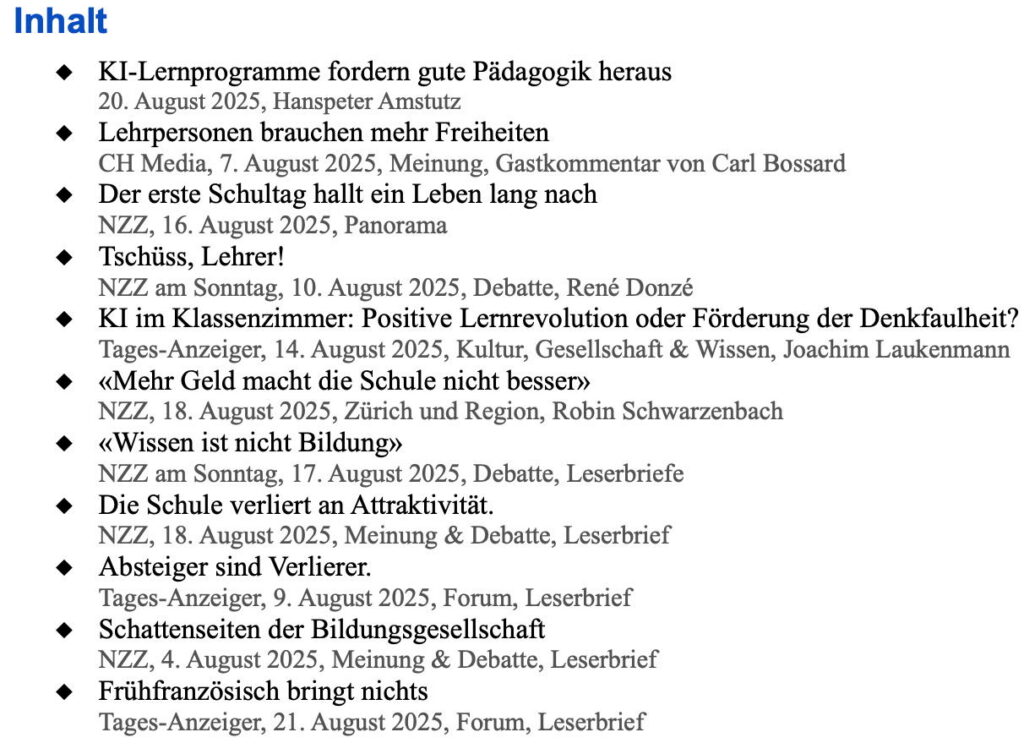KI-Lernprogramme fordern gute Pädagogik heraus
Wie wichtig es ist, dass am ersten Schultag eine freundliche Lehrerin die Kinder empfängt, zeigen Rückblicke bekannter Persönlichkeiten auf ihren Schulstart. Übereinstimmend schildern alle, dass sie den ersten Schultag in freudiger, meist gespannter Erwartung erlebt haben. In solchen Augenblicken sind die Sinne hellwach. Die neue Lehrerin wird genau beobachtet, das Schulzimmer mit seinen spezifischen Ausstattungen als zweites Zuhause sorgfältig registriert und selbst Gerüche werden oft intensiver wahrgenommen. Am interessantesten sind zweifellos die neuen Mitschülerinnen und Mitschüler, die neugierig oder eher scheu in die Runde blicken.
Die Hauptperson im Zimmer ist die Lehrerin, denn auf sie wird es in den nächsten drei Jahren ankommen. Wie eine gute Dirigentin, die mit Engagement ein Musikstück einübt und das beste aus ihren Musikern herausholt, möchte sie ihre Klasse führen.
Freiheit und Verantwortung gehören untrennbar zum Lehrerberuf
Carl Bossard schildert in seinem befreienden Eingangstext, worauf es ankommt, damit der Schulstart gelingt. Der Autor wählt dafür das Bild einer Seefahrt auf einem grossen Segelschiff. Die Verantwortung für das Boot, in welchem sich eine zwanzigköpfige Schülerschar auf ein fernes Ziel hin aufmacht, liegt beim Kapitän. Er hat alle nötigen Vorbereitungen getroffen und sorgt dafür, dass die Stimmung an Bord voll Zuversicht ist. Dafür benötigt er Entscheidungskompetenzen, die nur eine umsichtige und von ihrem Auftrag überzeugte Persönlichkeit treffen kann. Ohne ein hohes Mass an Freiheiten ist es jedoch schwierig, die alltäglichen Herausforderungen an Bord flexibel zu meistern. So ist es der Kapitän, der weiss, wie viele Segel im Sturm zu setzen sind und nicht ein Stabsoffizier im Flottenkommando.
Carl Bossards Bild lässt sich leicht auf die heutige Schulsituation übertragen. Lehrersein bedeutet, ja zu sagen zu einer verantwortungsvollen Führungsaufgabe. Dafür kaum geeignet sind farblose Lerncoachs, die sich eng an getaktete Teilkompetenzziele halten. Diese Erkenntnis ist nicht neu, aber die Vorstellungen von brav ausführenden Pädagogen haben sich unterdessen zu einem vollständigen Ersatz von Lehrkräften durch KI gesteigert. Der doppelseitige Beitrag mit dem provokativen Titel «Tschüss Lehrer» aus der NZZ am Sonntag gibt einen ersten Überblick zu den abstrusen Verheissungen, die mit seriöser Pädagogik jedoch nichts mehr zu tun haben.
Lernen mit einem lebendigen Gegenüber hat eine andere Qualität
Kinder wollen angesprochen werden. Sie entfalten sich, wenn sie einen Menschen erleben, der ihnen in verständnisvoller Art mit einer Lernbotschaft gegenübertritt. Es ist die primäre Art des schulischen Lernens und nimmt in der Volksschule die meiste Zeit ein. Es braucht schon sehr viel Unkenntnis der menschlichen Natur, um sich ausmalen zu können, künstliche Intelligenz werde künftig zu grossen Teilen diese Beziehungsfunktion übernehmen. Wir halten uns vor Augen:
-
Gute Lehrkräfte sind imstand, bei einem Thema alle Register zu ziehen, um das Lernen attraktiv zu machen. Ihre Motivationskunst und ihre Fähigkeit zur Empathie spielen dabei eine zentrale Rolle. Darin sind gute Lehrkräfte jeder KI-Software hoch überlegen.
-
Lernen ist ein Vorgang, den die Schüler aktiv mitgestalten müssen. Intensives Lernen verlangt Konzentration und Ausdauer. Für jüngere und leicht ablenkbare Schüler ist ein von einer Lehrerin geführter Lernprozess klar erfolgversprechender als das Arbeiten mit KI.
-
Die Volksschule ist der Ort, wo gemeinsames Lernen stattfindet und gegenseitige Rücksichtnahme praktisch eingeübt werden kann. Dieses Miteinander steht im Gegensatz zu einem von KI-Lernprogrammen geprägten Unterricht, welcher der Vereinzelung der Schüler hinter Bildschirmen Vorschub leistet.
-
Jugendliche wollen ihre Lehrerinnen und Lehrer authentisch in möglichst vielen Lernsituationen erleben. Wie ein Lehrer zu seinem Fach steht und mit welcher Leidenschaft er spannende Bildungsinhalte vermittelt, ist psychologisch von zentraler Bedeutung.
Zweckmässiger KI-Einsatz in der Sekundarschule
-
Disziplinierten Schülern bietet sich die Chance, einzelne Themen selbständig zu vertiefen oder mit unterstützendem Coaching selber zu erarbeiten. Dafür gut geeignet sind Inhalte aus den Realienfächern Geografie und Biologie.
-
Im Fremdsprachenunterricht bietet zweckmässig eingesetzte KI vielfältige Trainingsmöglichkeiten und Übersetzungshilfen für sprachinteressierte Schüler.
-
Anschauliche KI-Erklärungsprogramme ermöglichen allen Lernwilligen, sich zuhause mit erarbeiteten Bildungsinhalten nochmals auseinanderzusetzen.
-
KI kann Lehrpersonen in manchen Fällen von Routineaufgaben entlasten, wenn individualisierte Übungsreihen von guter Qualität zur Verfügung stehen. Auch das Korrigieren von Übungen kann so vereinfacht werden.
Starke Nebenwirkungen bei einer Überdosis von KI im Unterricht
Der Erwartungsdruck vieler Eltern an eine Schule mit einem umfassenden KI-Lernkonzept dürfte gewaltig steigen. Viele erwarten höchste Förderleistungen in den als wichtig erachteten Hauptfächern. Bildung wird als Konsumgut verstanden, das die Schule jedem Kind massgeschneidert anbieten muss. Es versteht sich von selbst, dass der Spielraum für kreatives Unterrichten dadurch massiv eingeschränkt wird.
Mit dem vermehrten Einsatz von KI-Programmen werden die Lernprozesse stark individualisiert. Diese didaktische Vorgabe belastet ab einem gewissen Ausmass jedoch das Schulklima erheblich. Forcierte Individualisierung lässt die Schere zwischen unterschiedlich begabten Schülern weit auseinandergehen und kann zu einem abnehmenden Gemeinschaftsgefühl führen.
Eine Überbewertung der neuen Lernmöglichkeiten könnte bei grossem Lehrermangel allenfalls dazu verleiten, ungenügend ausgebildete Hilfslehrkräfte mithilfe von KI-Lernprogrammen den Schulbetrieb organisieren zu lassen. Dieses düstere Szenario einer mechanistisch verstandenen Pädagogik ohne jede Empathie für die Kinder gilt es unbedingt zu verhindern.
KI zwingt zu einem Überdenken der Lehrerbildung
Für praxisferne Fachdidaktik ist künftig kein Platz mehr vorhanden. Nur klare und anschauliche Instruktionen zu einem Bildungsinhalt haben eine Chance, den gut verständlichen Erklärungen mancher KI-Programme mindestens ebenbürtig zu sein. Die Fachdidaktiken müssen entsprechend aufrüsten und die allgemeine Didaktik wird die Aufgabe haben, die Lehrerpersönlichkeit der Studierenden stärker zu fördern. Themen wie Klassenführung, stoffliche Kompetenz oder didaktisches Können gehören zum Kern dieser Ausbildung und kommen klar vor dem Verfassen zeitraubender Abhandlungen.
Ebenso gilt es, die vernachlässigte Kunst des intensiven Übens zu regenerieren. Gemeinsames Üben mit kreativen Elementen hat für die Schüler einen ganz anderen Stellenwert als das Arbeiten mit unpersönlichen Lernprogrammen. Ein geführtes Aufbautraining zeigt eine bessere Wirkung als ein zu früh an KI-Programme delegiertes Üben. Die Lehrerbildung wird gründlich über die Bücher gehen müssen.
Ein Zürcher Stadtrat und unsere Leserbriefschreiber reden Klartext
Im Schlussbouquet finden Sie ein aufschlussreiches Interview mit dem abtretenden Schulvorstand Filippo Leutenegger und eine grössere Auswahl an aussagekräftigen Leserbriefen. Es ist dabei bemerkenswert, welch ungeschönte Bilanz Stadtrat Leutenegger zum gescheiterten Frühsprachenkonzept und zur schulischen Integration zieht. Die Leserbriefschreiber stehen ihm in ihren Texten in nichts nach. Sie alle reden erfrischenden Klartext.
Wir wünschen Ihnen ein spannendes Lesevergnügen.
Hanspeter Amstutz