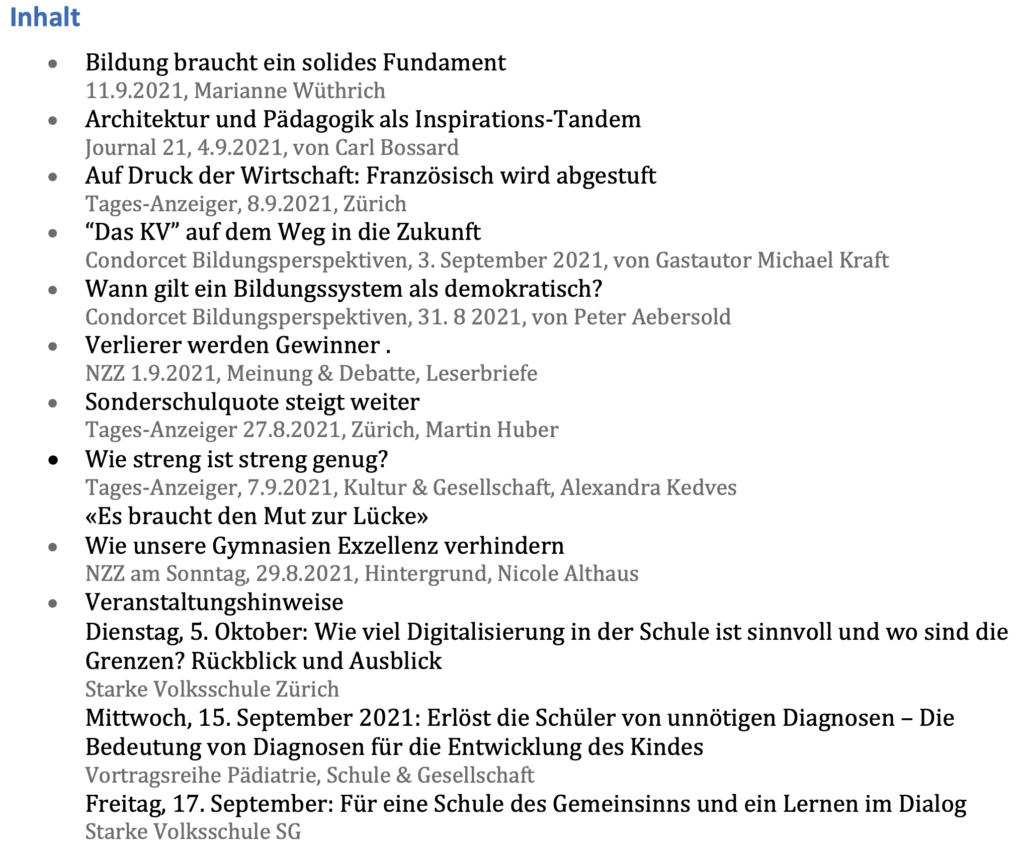Bildung braucht ein solides Fundament
Schwerpunkte unseres Newsletters sind die Dauerbrenner KV-und Gymi-Reformen, wir erinnern aber auch beharrlich daran, dass die Grundlagen für ein gedeihliches Lernen in der Sekundarstufe II schon in der Volksschule gelegt werden müssen.
Als Auftakt beleuchtet unser Freund Carl Bossard die pädagogische Welt dieses Mal aus einem etwas anderen Blickwinkel.
KV-Lehre als echten Weg in die Zukunft für unsere Jugend erhalten
Eine Kurznachricht im Tages-Anzeiger zur Zürcher Umsetzung der KV-Reform im Bereich Fremdsprachen nennt mehrere Neuerungen, die bei der Leserin ein grosses Fragezeichen hinterlassen.
Französisch soll nur noch in den ersten zwei Jahren im Lehrplan stehen, in der Attestlehre sogar nur noch als Freifach. Dem inneren Frieden unter den Schweizer Sprachregionen wird diese Neuerung nicht dienen. So nebenbei wird ausserdem offengelegt, dass das B-Profil (heute mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ) faktisch zur Attestlehre herabgestuft werden soll. Englisch wird nicht mehr als eigenständiges Fach mit einem strukturierten Aufbau gelehrt, sondern «in konkreten Arbeitssituationen» im Bereich «Berufskunde». Hier werden die Aufgaben der drei Bildungsträger in der dualen Berufsbildung kräftig durcheinandergemixt: Sache der Berufsschule ist es, die sprachlichen Grundlagen zu legen, Sache der Lehrbetriebe und der Branchenverbände muss die Anwendung in der realen Arbeitswelt bleiben.
KV-Bildungsleiter Michael Kraft versucht in seiner Stellungnahme die Reform als «Weg in die Zukunft» schönzureden und argumentiert, es seien ja alle beteiligten Kreise dafür, auch die Arbeitgeber- und Branchenverbände. Allerdings gilt dies vor allem für deren Verbandsspitzen. Wenn diese eine sogenannt «handlungskompetenzorientierte» Ausbildung an der Berufsschule befürworten, schieben sie einen Teil ihrer ureigenen Aufgaben den Schulen zu.
Theoretisch geübte «Praxisnähe» bleibt an der Oberfläche
Die Berufsausbildner in den Betrieben werden es den Verbänden nicht danken, wenn ihre Lehrlinge mit theoretisch geübter «Praxisnähe» aus der Schule kommen, denn in Wirklichkeit kann zum Beispiel das «Gestalten von Kunden- und Lieferantenbeziehungen» nur in der realen Arbeitswelt gelernt werden. Und die Englischlehrerinnen werden auch lieber und besser weiterhin ihre Sprache unterrichten als sich in verschiedene Branchenkenntnisse einarbeiten zu müssen.
Auch überzeugt Krafts Argument wenig, das KV müsse unbedingt reformiert werden, weil seit zwanzig Jahren keine grosse Reform mehr stattgefunden habe. «Neu isch immer guet», hat einer meiner Rektoren an der Berufsschule gesagt – bei den Bildungsreformen der letzten Jahrzehnte ist dies leider mehrheitlich nicht der Fall.
Leidtragende der Reform werden an erster Stelle die Jugendlichen sein, die darauf vertrauen, mit dem KV eine gute Lehre machen zu können. Einer der schwerwiegendsten Einwände gegen das Projekt «KV 2022» ist die nicht mehr gewährleistete Durchlässigkeit. Sie hat über viele Jahrzehnte gut funktioniert und ist ein Markenzeichen der exzellenten dualen Berufsbildung der Schweiz. Auch guten Absolventen der Attestlehre wird es nur schwer möglich sein, eine KV-Lehre EFZ anzuhängen, vor allem wenn ganze Fächer wie das Französisch fehlen. Und wenn die Berufsmatura, die ihren anspruchsvollen Fächerkanon behalten wird, kaum mehr erreichbar ist für einen «handlungskompetenten» KV-Lehrling, droht das KV seine Anziehungskraft zu verlieren.
Fazit: Zurück auf Feld 1!
Demokratisch verfasste Volksschule und Chancengleichheit
Damit wir uns in den aktuellen Bildungsreformen nicht verheddern, empfiehlt es sich innezuhalten und mit Peter Aebersold die demokratischen Grundlagen der Schweizer Volksschule zu ihren historischen Wurzeln zurückzuverfolgen. Es ist eindrücklich, von Ludwig Snell, einem Politiker und Gelehrten des 19. Jahrhunderts, zu lesen, der als obersten Zweck der Erziehung die Ausbildung aller werdenden Bürger zur Würde freier Vernunftwesen ansah. Dahinter stand eine wahrhaft demokratische Gesinnung. Chancengleichheit in diesem Sinne bedeutet – um mit heutigen Schulpolitikern zu sprechen – nicht, dass jedes Kind in der Regelklasse sitzen muss, sondern dass jedes die Möglichkeit angeboten bekommt, seine Chance zu packen und seinen Weg im Leben zu finden, natürlich mit der Unterstützung seiner Lehrerinnen und Lehrer. Dass diese auch Quereinsteiger sein können, von denen manch einer mit seiner eigenen Lerngeschichte zuweilen den Faden zu einem Kind mit Lernschwierigkeiten besonders gut finden kann, darauf weisen die beiden Leserbriefschreiber hin («Verlierer werden Gewinner»). Allerdings müsste unsere Schulpolitik die neuen Lehrerinnen, die mit Schwung einsteigen, auch «bei der Stange zu halten» versuchen – mit kleineren, homogeneren Klassen (Regelklassen und Kleinklassen), so dass sie als Klassenlehrerinnen nicht im Schreibkram und der Organisation im Grossraumbüro ertrinken, sondern ein möglichst hohes Pensum verkraften können und auch Freude daran haben.
Sparen auf Kosten der Schwächsten?
Ganz im Widerspruch dazu steht die Idee der Zürcher Bildungsdirektion, die zunehmende Zahl von Schülern mit Sonderschulungsbedarf dadurch zu verkleinern, dass man «das Personal in den Regelklassen» einer Zusatzausbildung unterzieht, damit es die Kinder, «die Mühe mit dem Schulstoff haben», «mittragen» kann («Sonderschulquote steigt weiter»). Als ob die heutigen Klassenlehrer nicht fähig wären, auch schwächere Schüler zu fördern und zu unterrichten. Aber eben nicht alle Kinder gleichzeitig, in derselben Klasse! Die Bildungsdirektion legt denn auch offen, worum es ihr tatsächlich geht: Der Mitteleinsatz in der Volksschule soll «vereinfacht» werden. Sprich: Es kommt billiger, möglichst alle Kinder in die Regelklassen zu setzen und erst noch zusätzliche Sonderschullehrer zu sparen, indem die Klassenlehrerin fit für Sonderschüler gemacht wird, als endlich die dringend nötigen Kleinklassen zu schaffen.
Ein Wort zur Maturitätsreform
Drei Artikel in unserer Sammlung befassen sich mit der Gymi-Reform. Dazu zusammenfassend einige grundsätzliche Bemerkungen. Es leuchtet jedem ein, dass nicht mehrere neue Fächer in die bereits reich befrachteten Lehrpläne hineingestopft werden können, ohne anderswo Abstriche zu machen. Es ist auch klar, dass nicht jede Schülerin in allen Fächern gute Noten erreicht. Schon in meiner Gymi-Zeit gab es Schüler, die ihre schlechte Mathe-Note mit guten Sprachnoten kompensiert haben und umgekehrt. Es muss nicht jeder alles perfekt können.
Aber die Diskussion, ob mehr Kompensation oder mehr Selektion vonnöten wäre an den Mittelschulen, läuft am Kernproblem vorbei. Tatsache ist, dass ein Maturand solide Kenntnisse sowohl in den naturwissenschaftlichen Fächern als auch in den Sprachen, besonders im Deutsch, aufweisen muss. Und wir kommen nicht daran vorbei, dass die Grundlagen in Deutsch und Mathematik in der Volksschule zu legen sind. Der Lehrplan 21 gewährleistet diese Grundlagen in keiner Weise. Wenn das Einmaleins nicht mehr beherrscht werden muss und die Lehrerin die Fehler im Aufsatz nicht mehr korrigieren soll, wenn der Stoff nicht in einem strukturierten Aufbau unterrichtet wird, sondern jedes Kind nach seinem Gusto «selbstorganisiert» an seinem Tablet sitzt, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn im Gymi nicht alle schreiben und rechnen können. Dass der frühere Rektor der Universität Zürich vor einigen Jahren feststellte, manche Studentinnen würden in ihren Prüfungstexten keinen korrekten deutschen Satz zusammenbringen und Mathematikprofessoren müssten einigen ihrer Studenten den Dreisatz beibringen, ist ein Alarmzeichen.
An diesem Kernpunkt sollte unsere Bildungspolitik ansetzen, wenn wir wieder gut und vielfältig gebildete Akademiker haben wollen. Dies übrigens auch aus Gründen der Chancengleichheit. Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: Ohne eine gute Volksschulbildung schaffen es immer weniger Kinder aus fremdsprachigen Familien oder mit sogenannt «bildungsfernen» Eltern an die Mittel- und Hochschulen.
Für die Redaktion «Starke Volksschule Zürich»
Marianne Wüthrich