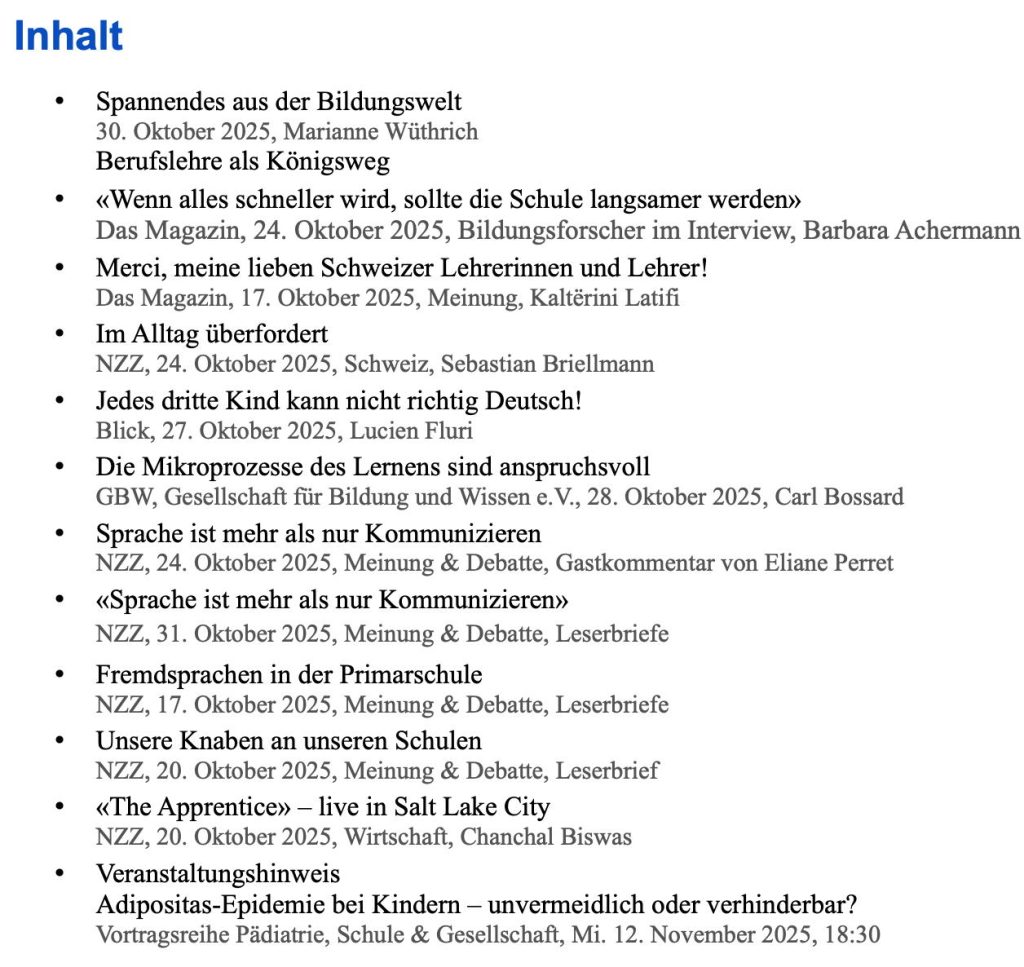Spannendes aus der Bildungswelt
30. Oktober 2025, Marianne Wüthrich
Was für eine faszinierende Textsammlung! Da wird man richtig gluschtig aufs Lesen. Besonders erfreulich: Alle Autoren landen mit ihren Überlegungen beim Grundsätzlichen, nämlich dass die Beziehung zum Erwachsenen, den Eltern und Lehrern, der wichtigste Faktor dafür ist, damit Kinder und Jugendliche mit Freude und Erfolg lernen können. Das weltweit positive Echo auf John Hatties Forschungen zeigt, dass sehr viele Lehrkräfte sich in ihren eigenen Erfahrungen bestätigt fühlen.
Wie lernen Kinder am besten?
Privilegiert sind nicht nur Kinder aus bildungsfördernden Familien, schreibt Roland Reichenbach, der selbst nicht aus einer Akademikerfamilie kommt, sondern auch Kinder, die von ihrer Lehrerin unterstützt werden – angeleitet, gefordert, zum Üben und Nichtaufgeben angespornt. Lernen macht eben nicht nur Spass, und Denken lernt man nicht mit selbstorganisiertem Klicken vor dem Bildschirm. Bei Reichenbach waren es der Klavier- und der Gitarrelehrer, die ihn für das Lernen und Üben begeistern konnten. Vieles andere mehr finden Sie im reichhaltigen Interview mit dem erfahrenen Pädagogikprofessor. Ein illustratives Beispiel zur Bedeutung der Lehrerinnen für ihr eigenes Leben erzählt uns Kaltërini Latifi in ihrem kurzen, aber berührenden Artikel.
Nichts Neues sind leider die Meldungen, dass erschreckend viele Menschen im erwerbsfähigen Alter einfache Sprach- und Rechenaufgaben nicht lösen können. Dass bei vielen Kindern ungenügende Sprachkenntnisse bereits vor dem Kindergarten manifest werden, ist auch bekannt.
Hier sind unterschiedliche Lösungsansätze gefragt. Bei Erwachsenen mit mangelhaften Sprach- und Mathematikkenntnissen stellt sich die Frage, warum sie in elf Jahren Kindergarten und Volksschule keine gefestigten Grundlagen erwerben konnten. Diese Problematik haben wir hier schon öfter thematisiert. Mit einer fremden Muttersprache allein ist sie jedenfalls nicht zu erklären. Viele Fremdsprachige bewältigen die Schule und die Lehre oder ein Studium erfolgreich, wenn sie bei ihren Lehrern eine gute schulische Basis erhalten haben. Carl Bossard legt einmal mehr differenziert dar, wie Lernen «geht» und weist darauf hin, dass unsere Schulen an erster Stelle gut ausgebildete Lehrerinnen und Heilpädagogen benötigen. Diese brauchen «ein waches Bewusstsein» für die feinen Abläufe der Lernprozesse und müssen die unabdingbare Ruhe und Konzentration in ihrem Klassenzimmer schaffen, ohne die gedeihliches Lernen kaum möglich ist.
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, muss es die Aufgabe des Lehrers sein, mit seiner Klasse den Unterrichtsstoff in einem strukturierten Aufbau zu erarbeiten – am besten mit einem vernünftigen Lehrplan als Hilfsmittel. Dann ist nicht einzusehen, warum nicht mindestens 95 Prozent der Schulabgänger gute Kenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen in ihr Leben mitnehmen, aber auch motorische und kreative Fertigkeiten sowie die Fähigkeit, sich mit den Fragen des Alltags und der Welt gedanklich auseinanderzusetzen.
Wie lernen Kinder sprechen?
Was die kleinen Kinder betrifft, bietet uns die Heilpädagogin Eliane Perret einen faszinierenden Einblick in den Erwerb der Erstsprache. Sie hält fest, dass es «der zwischenmenschliche Bezug ist, der den Spracherwerb möglich macht – was niemals durch Medien ersetzt werden kann.» Erstaunlich, in wie kurzer Zeit Kinder in den ersten Lebensjahren die Struktur ihrer Muttersprache und einen ansehnlichen Wortschatz lernen – wenn mit ihnen regelmässig gesprochen wird und sie sich gefühlsmässig an ihre Mutter oder andere Menschen gebunden fühlen. Das erinnert mich an ein Plakat mit dem Bild einer Mutter, die ihren Kinderwagen schiebt und dabei ganz in ihr Handy versunken ist, und dem Text: «Heute schon mit Ihrem Kind gesprochen?»
Die Frage, wann Kinder in der Schule Fremdsprachen lernen sollen, darf nicht aus der Sicht ehrgeiziger PH-Dozenten und wohlmeinender, aber sich irrender Bildungspolitiker gelöst werden, sondern einzig vom psychologisch-pädagogischen Standpunkt aus. Die Erstsprache muss «im Bildungsprozess von Kindern eine hervorragende Bedeutung haben», schreibt die Autorin. Daraus ergibt sich, dass die richtige Zeit für Fremdsprachen für die meisten Kinder erst etwas später kommt.
Berufslehre als Königsweg
Nun komme ich aber zu meinem eigentlichen Wunschthema: dem unschätzbaren Wert des dualen Bildungssystems für unsere Jugend und für das ganze gesellschaftliche Zusammenleben in unserem Land. Eine ausführliche Reportage über die Berufslehre bei Stadler Rail in den USA von NZZ-Redaktor Chanchal Biswas führt uns vor Augen, was wir an der Schweizer Berufslehre haben und dass sie sich auch nicht einfach exportieren lässt. Hier einige zentrale Punkte.
Keine Fachkräfte, keine Schrauben
Als Stadler Rail vor zehn Jahren in Salt Lake City mit dem Bau von Eisenbahnen für einen Grossauftrag starten wollte, stellten die Schweizer fest, dass in ganz Utah noch nie jemand einen Zug gebaut hatte. Es gab keine Fachkräfte, und die Schrauben und Werkzeuge mussten aus Europa beschafft werden. Also taten die Schweizer Berufsleute in der Geschäftsleitung das, was in der Schweiz fast jedes Unternehmen tut: Sie begannen, Lehrlinge auszubilden. Heute arbeiten dort 650 kompetente Mitarbeiter.
USA: Jobben oder Studieren
In den USA geht man laut dem Autor nach der Highschool wenn immer möglich an die Uni. Wer das nicht schafft und vor allem, wer das Geld für ein Studium nicht aufbringen kann, geht jobben – falls er einen Job findet. Berufliche Ausbildung gibt es in der Regel keine. Gelernt haben die meisten jungen Leute, bevor sie als Lehrlinge zu Stadler kamen, nur das, was sie für ihre Arbeit gerade können mussten. Die Kombination von praktischer Arbeit / Ausbildung und theoretischer Ausbildung war für die Lehrlinge und ihre Familien neu. Besonders attraktiv ist die Tatsache, dass man dafür nicht bezahlen muss wie für das Uni-Studium und nachher auf einem Schuldenberg sitzt, sondern dass man eine unentgeltliche Schulbildung erhält und erst noch einen Lohn bekommt.
Schweiz: Gesellschaftsvertrag auf der Basis des genossenschaftlichen Prinzips
Das Schweizer Berufsbildungssystem ist historisch gewachsen. Die Berufslehre hat sich vor allem in den Zünften der Deutschschweizer Städte entwickelt, wo eine hohe Qualität der Produkte und die Ausbildung des Nachwuchses Hand in Hand gingen. Deshalb ist in der Deutschschweiz auch heute die Berufslehre mehr verbreitet als in der Romandie oder im Tessin. Es gibt Leute, die drängen, die Maturitätsquoten sollten gesteigert werden. Nun, ich selbst habe die Matura gemacht und will gewiss niemanden von diesem Weg abhalten. Aber wir können es nicht genug hochschätzen, dass zwei Drittel der Jugendlichen eine Berufslehre absolvieren. Wer drei oder vier Jahre lang im Betrieb und in der Berufsschule die Ärmel hochkrempelt und durchhält, hat oft bessere Chancen für seinen weiteren Lebensweg (nicht nur in beruflicher Hinsicht) als mancher Gymischüler, falls dieser dazu neigt, sich bequem durchzuschlängeln. Im Lehrbetrieb geht das in der Regel nicht, weil man da auf den faktischen Einspruch der realen Anforderungen und auf Ausbildner stösst, die dagegenhalten. Gerade in heutigen Zeiten ist dies für den Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft von grosser Bedeutung. Ein weiterer wichtiger Vorteil des dualen Berufsbildungssystems ist die rekordtiefe Jugendarbeitslosigkeit in der Schweiz.
Neben dem Willen der Jugendlichen, eine Lehre zu machen, ist der zweite unerlässliche Faktor die Bereitschaft der allermeisten KMU, aber auch der Grossbetriebe (soweit ihre Chefetage mehrheitlich aus Schweizern besteht), Lehrlinge auszubilden. Das funktioniert nur deshalb, weil das Gros der Unternehmer nicht nur gute Leute für den eigenen Betrieb ausbilden will – das natürlich auch – sondern sich ausserdem mitverantwortlich fühlt für die Ausbildung der jungen Generation als Basis von Wirtschaft, gesellschaftlicher Solidarität und demokratischer Teilhabe. Ein drittes Markenzeichen der modernen Schweizer Berufsbildung ist die Durchlässigkeit, die es motivierten jungen Leuten ermöglicht, nach der Lehre zum Beispiel ein Studium anzuschliessen. NZZ-Wirtschaftsredaktor Chancal Biswas: Das duale Bildungssystem mit Berufslehre und Hochschule ist «fest in der Gesellschaft und im Selbstbewusstsein des Landes verankert. Es schliesst niemanden aus, ist durchlässig, und bringt – Lehre sei Dank – Fachkräfte hervor, die auch wirklich etwas können. Es ist ein Erfolgsmodell…»
Warum in die Ausbildung seiner Mitarbeiter investieren, wenn sie dann abspringen?
Anders beschreibt die NZZ die Einstellung vieler Unternehmer in den USA. «Warum sollte ein Betrieb in die Ausbildung seiner Mitarbeiter investieren, wenn sie dann von einem Wettbewerber abgeworben werden? Warum sollte man als Angestellter länger bei Stadler bleiben, wenn einem doch überall sonst beigebracht wird, dass man alle zwei bis drei Jahre den Job wechseln soll, um den Lohn zu erhöhen?» Auch die Zuverlässigkeit und die Bereitschaft mancher Lehrlinge, Verantwortung für die Qualität der Produkte und für das positive Image ihres Lehrbetriebs zu übernehmen, musste zuerst gelegt werden. Die Schulausbildung am College muss bisher Stadler Rail organisieren und finanzieren. Immerhin ist es in Utah gelungen, das Interesse der zuständigen Behörden und Hochschulen zu gewinnen, und erfreulicherweise haben sich vier weitere Firmen der Lehrlingsausbildung angeschlossen.
Fazit: Wir tun gut daran, unser hervorragendes Berufsbildungssystem wertzuschätzen und zu pflegen. Dazu gehört selbstverständlich auch, dass wir wieder für eine Volksschule sorgen, wo die Kinder lernen zu lesen, zu rechnen, zu schreiben, einen Hammer richtig in die Hand zu nehmen und einiges mehr. Redaktor Biswas: «Wenn die Amerikaner einen Schweizer Zug bestellen, kaufen sie auch ein Versprechen. Es fallen Begriffe wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Qualität.» Und: In Schweizer Betrieben lernen die Mitarbeiter, dass die Verantwortung für die Qualität der Produkte «bei jeder und jedem Einzelnen liegt.»
Marianne Wüthrich